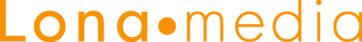Malerei als Überlebensmittel: Film über Arno Rink feiert Premiere
25.04.2018
Leipziger Volkszeitung
back to selection
Unter dem Titel „Ich male!“ ist eine große Retrospektive Arno Rinks im Museum der bildenden Künste in Leipzig zu sehen. Dort feierte am Montagabend die aus diesem Anlass entstandene Dokumentation der Berliner Filmemacherin Nicola Graef Premiere. Der Film ist berührend und aufschlussreich.
Im Atelier ist die Stille zu greifen, wird die Abwesenheit fühlbar. Da liegen sie noch, als würden sie jeden Moment wieder aufgenommen – die Pinsel, die Farbtuben, die Tücher. Doch es bleibt ein Stillleben. Arno Rink, der hier mit seinen Dämonen und Zweifeln rang, jene so schmerzenden wie zeitlos schönen Bilder malte, wird nicht wieder zur Tür hereinkommen und einfach weitermachen. Der Leipziger Maler ist am 5. September 2017 gestorben. Unter dem Titel „Ich male!“ ist seine große Retrospektive bis 19. August im Museum der bildenden Künste in Leipzig zu sehen. Dort feierte am Montagabend die aus diesem Anlass entstandene Dokumentation der Berliner Filmemacherin Nicola Graef in einer geschlossenen Veranstaltung Premiere.
Der Film „Der Maler Arno Rink – Wegbereiter der Leipziger Schule“ (es geht eigentlich um die „Neue Leipziger Schule“) beginnt im Schmerz, auf dem Leipziger Südfriedhof, mit der Rede seiner Frau Christine, die fünf Jahrzehnte mit ihm zusammenlebte. „Gott ist auch barmherzig, er gibt uns die Kraft der Erinnerung“, sagt sie. Graef, deren Film „Neo Rauch – Gefährten und Begleiter“ 2016 ins Kino kam, ist Arno Rink nur einmal kurz begegnet.
Nah kommt sie ihm dennoch, vielleicht gerade deswegen, denn Arno Rink mied die Öffentlichkeit, machte ungern viel Aufhebens um sich. Seine Abwesenheit – Rink ist nur in einigen wenigen bewegten Archivaufnahmen zu sehen – wird zu einer immer intensiveren Anwesenheit – mit Bildern und Gedanken, die sich nicht einfach abstreifen lassen. „Ich finde den Film großartig. Ich stehe noch ganz in seinem Bann“, sagt Neo Rauch in einer anschließenden von Thomas Bille moderierten Gesprächsrunde mit Graef und Rink. Rauch gehört zu denen, die im Film über ihren Mentor, Motivator, Freund, Ehemann und Vater sprechen. Viele von ihnen sind gekommen. So gerät dieser Abend nebenbei zu einem Klassentreffen der Leipziger Schule.
Dicht und berührend
Der knapp einstündige Film ist ein Glücksfall – dicht und berührend porträtiert er einen bedeutenden, sich im besten Sinne schlecht verkaufenden Maler. Ausstellung und Film haben eine klare Botschaft: Die Kunstwelt hat mit Arno Rink nicht nur eine Persönlichkeit, einen verehrten, auch in schwierigen Zeiten aufrechten und inspirierenden Lehrer verloren, sondern einen hochsensiblen Künstler, der ein übersichtliches, aber durch die Jahrzehnte erstaunlich homogenes und tiefgreifendes Werk geschaffen hat. „Er malte Bilder, die unter die Haut gehen“, meint seine Frau und Kritikerin.
Die Arbeit, sagt Tochter Marie-Thérèse, sei für ihn lebenserhaltend gewesen. Das Atelier ist ihm Zufluchtsort und Trutzburg. Rink ist zeitlebens ein Suchender, ein Getriebener, den Depressionen quälen. „Sein Innenleben muss eine Art Vorhölle gewesen sein“, sagt sein Schüler und Freund Neo Rauch. Seine Frau erlebt ihn „in allen diesen Phasen bis hin zu stationären Aufenthalten“. Doch nach drei Tagen, erzählt sie, „fingen sie dort in der Gruppe an zu malen“.
Malerei als Überlebensmittel: nach der Krebsdiagnose vor 20 Jahren, als poetische Landschaften mit weiten, tiefen Himmeln entstehen. In der Wendezeit, die Rink als einzigen Rektor einer ostdeutschen Kunsthochschule im Amt übersteht. In den frühen 90ern, als die Malerei, insbesondere die figurative, für tot erklärt wird.
Subtil zeichnet der Film ein Leben, das die Umstände in Kauf nimmt, ohne sich ihnen anzubiedern. „Er hasste die Gleichmacherei“, sagt Neo Rauch. Und Christine Rink erzählt: „Er hat die Position der Demonstranten bezogen.“ Bizarr komisch sind die Archivaufnahmen, die Rink dabei zeigen, wie er unter anderem Erich Honecker und Egon Krenz ein für das Gewandhaus entstandenes Bild erklärt – und in leere Gesichter spricht.
„Kann man so machen“
Im Film klingt an, wie die Hochschule für Grafik und Buchkunst unter ihren Rektoren Bernhard Heisig und Arno Rink zu einem Ort der Freiheit wird. Galerist Gerd Harry Lybke erzählt, wie Heisig Forderungen nach Einflussnahme abtropfen ließ: „Wir haben hier keinen Platz, um Marxismus-Leninismus zu unterrichten. Die HGB hat zu wenige Zimmer.“ Und natürlich feiert der Film den Lehrer, den Malermacher, ohne den laut Lybke das, was man die Neue Leipziger Schule nenne, nicht denkbar sei. „Er war eine Autorität, die niemand in Frage stellen wollte“, beschreibt ihn Rauch. „Was glauben Sie, könnte das Problem sein?“, habe er seine Schüler gerne gefragt, berichtet Katrin Heichel. Mit Lob sei Rink sparsam umgegangen. „Kann man so machen“ sei so ziemlich das Höchste gewesen. Oder die Aufforderung, ein Bild erneut zu malen.
Der Film badet nicht in der Trauer, aber es ist vielleicht sein einziges Manko, dass er zu früh nach Rinks Tod begonnen wurde. Das leere Atelier, sagt Christine Rink gegen Ende, erzeuge ein großes Gefühl der Einsamkeit. „Ich lebe aber mit seinen Bildern. Das lässt mich fröhlich sein.“
back to selection