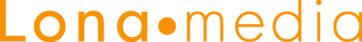Bis zum letzten Atemzug
02.04.2008
Kölner Stadtanzeiger
zurück zur Auswahl
von Georg Imdahl
Jörg Immendorff in seinem Düsseldorfer Atelier.
Gegen Ende dieses Films ist der Maler noch einmal unter Leuten und doch plötzlich ganz allein. Gerhard Schröder ist in sein Düsseldorfer Atelier gekommen und erweist seinem Porträtisten, einem Mann im Rollstuhl, die Ehre, um sich das offizielle Kanzlerbild auf der Staffelei anzuschauen. Als der Altkanzler in Smalltalk verwickelt wird, kehren er und seine Gesprächspartner Jörg Immendorff den Rücken. Mit Händen greifbar sind in diesem Moment die ganze Erschöpfung und die Einsamkeit des Künstlers, dem nun jeder Atemzug eine Anstrengung bedeutet. Doch Immendorff relativiert das Schicksal und seinen nahenden Tod. Jeder Mensch werde mit der Grenzsituation konfrontiert, der er sich jetzt stellen müsse, mit Krise, Einsamkeit, Leiden. Dabei stehe außer Frage, dass „Energien übrigbleiben“, wenn jemand diese Welt verlassen hat.
Es ist das Verdienst der großartigen Dokumentation „Ich. Immendorff“ von Nicola Graef, die enormen Energien des Künstlers authentisch zu vermitteln, die er in seinen letzten beiden Lebensjahren gegen alle Anfeindungen der unheilbaren Nervenkrankheit ALS behauptete. Dem üblichen Sprachgebrauch folgend, wäre Immendorff der tückischen und qualvollen Krankheit „zum Opfer gefallen“, die erst die Gliedmaßen, dann die Lunge erlahmen lässt - doch in keinem einzigen Augenblick des knapp hundert Minuten langen Films geriert sich Immendorff als Opfer höherer Gewalt. Dass er sich auf das Filmporträt überhaupt eingelassen hat, er der Kamera ausdauernd und gefasst ins Auge sieht, als es um seine Gesundheit immer schlechter bestellt ist, macht diesen Film zu einer außerordentlichen Quelle für den Umgang eines Malers mit einem der zentralen Themen der Kunst.
Entstanden ist ein Künstlerporträt, zugleich aber auch eine Fallstudie über den Tod, was den Film über die Kunstszene hinaus interessant und fesselnd macht. Immendorff, der sich in jüngeren Jahren in so vielen Rollen geriert hatte - als Revoluzzer und Provokateur, als Partylöwe, Dandy und Exzentriker - streift in diesem finalen Film jegliches Klischee ab. Seine Rolle besteht nur mehr in der Charakterfigur, die sich von ihrer ausweglosen Situation nicht irre machen lässt. Es war die Malerei, die Immendorff bis zuletzt motivierte. Das Atelier war Ort des Weitermachens. Immendorff wirkt in jeder Szene konzentriert. Was er über das Entstehen des Bildes erzählt, über die Entscheidung, wann es als vollendet gelten darf, bleibt über weite Strecken völlig losgelöst von Krankheit. Immendorff stemmt in dieser Zeit seine vielleicht wichtigste Ausstellung überhaupt, die große Retrospektive in der Nationalgalerie in Berlin, wobei er hier schon zum Regisseur des eigenen Ruvres geworden ist.
Der Film der langjährigen Moderatorin der Sendung „Westart am Sonntag“ im WDR-Fernsehen beantwortet Fragen, die man sich angesichts einer ungebrochenen Produktion unweigerlich hatte stellen müssen: Wie sollte man sich die Arbeit im Atelier eigentlich vorstellen - bei einem Maler, der seine Arme kaum noch gezielt einsetzen konnte? Wiederholt sieht man Immendorff kurz angebunden Anweisungen an die Assistenten erteilen, wird Zeuge der Genese und Korrektur der Bilder, ihrer Farben und Konturen, und einmal sieht man Immendorff sogar eigenhändig zeichnen. Mit einer Schiene an Hand und Arm karikiert er den vor ihm sitzenden Künstlerkollegen Jonathan Meese; dann folgt der Film dem leidenschaftlichen Lehrer in die Düsseldorfer Kunstakademie, wo ein Student um Aufnahme in die Immendorff-Klasse bittet. Der Maler erteilt ihm eine schnöde, schmerzliche Abfuhr. „Damit ist nichts zu machen bei mir“, bescheidet er den Bewerber, der enttäuscht seine Mappe packt. Alltag in der Akademie, bis zuletzt.
Auch Graef kann sich zwar nicht dazu durchringen, auf das übliche Musikgedudel und Geklimper zu verzichten, das in so vielen Filmen über die bildende Kunst eingespielt wird, wenn den Bildern selbst einmal etwas Zeit zugestanden wird. Doch sind dies eher marginale Kritikpunkte in einem Charakterbildnis, das die biografischen und künstlerischen Wegmarken mit einfachen Mitteln klug in Erinnerung ruft. Köstlich die Originalaufnahmen der späten 60er Jahre, als Immendorff in Bonn einen Holzklotz in Schwarz-Rot-Gold auf dem Boden schleift und eine rüde Ordnungsmacht - wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses - zum Eingreifen reizt.
Graef lässt Galeristen, Künstler, Museumsleute zu Wort kommen, darunter Michael Werner, Kasper König, Franz Erhard Walther und Markus Lüpertz, der von den Sauf- und Sex-Gelagen auf der Reeperbahn erzählt. Den stärksten Eindruck hinterlässt Immendorffs Mutter Irene. Sie hatte ihren Mann, einen Militär, nach dessen endlosen erotischen Eskapaden vor die Tür gesetzt, woraufhin der sich in der eigenen Garage das Leben nahm. Immendorff macht kein Geheimnis daraus, wie sehr ihn der Tod und die Trennung getroffen hatten, und er bedauert, dass er kein Gespräch mehr „auf Augenhöhe“ mit dem Vater führen konnte. Auf einem Foto sieht man Jörg und seinen Vater im Wohnzimmer, die Wand überm Sofa ist mit zahlreichen Gewehren geschmückt. Ein wahrhaft skurriles Bild. Womöglich eine von vielen Quellen eines künstlerischen Werks, das sich mit Verve gegen die Konventionen seiner Zeit auflehnte.
„Ich.Immendorff“ läuft am 22. Mai in den Kinos an.
Am 1. Juni wird der Film beim fünften KulturSonntag des „Kölner Stadt-Anzeiger“ im Filmforum des Museum Ludwig aufgeführt.
zurück zur Auswahl