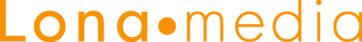Jörg Immendorffs letzte Stunden
22.05.2008
Die Welt
zurück zur Auswahl
Fast vor einem Jahr ist der Maler Jörg Immendorff der Nervenkrankheit amyotrophe Lateralsklerose erlegen. Die letzten zwei Jahre vor seinem Tod begleitete ihn Nicola Graef mit der Kamera. Jetzt läuft ihre großartige Dokumentation "Ich. Immendorff" in den Kinos. Von dem Zuschauer verlangt dieser gnadenlose Film jedoch einiges ab.
Jörg Immendorff hat öffentlich gelebt, exzessiv und für manche provozierend. Seine Inszenierung war ein Teil seiner Kunst. In den Achtzigern besaß er eine hübsch verruchte Kneipe inmitten von St. Pauli, da hockte der Kunstprofessor dann in monströser Lederkluft und goldener Uhr mit Tigerkopf am Gelenk, die jeden Mafiaboss wohl neidisch gemacht hätte. 2004 geriet er nach einem Kokain-Skandal mit ein paar Damen des Gewerbes in die Schlagzeilen. Er lebte, wie er malte. Unersättlich in seinen Leidenschaften. Er mischte sich ein, malte das „Café Deutschland“ und Kumpel Gerhard Schröder, mit dem er befreundet war, als goldenen Kanzler.
Da passt es ins Bild, dass Immendorff einwilligte, einen Film zu machen, auch wenn es ein Film wurde über das Sterben. Die letzten zwei Jahre vor seinem Tod im Mai 2007 begleitete ihn Nicola Graef mit der Kamera. Da lebte er schon sieben Jahre im Bewusstsein seiner tödlichen Krankheit: ALS, amyotrophe Lateralsklerose – das ist eine irreversible Muskellähmung am ganzen Körper.
„Ich. Immendorff“ heißt Graefs Film. Kein Kino für großes Publikum. 98 großartige Minuten. Vorausgesetzt, der Kinobesucher hält diese Art der Konfrontation aus. Großartig, weil gnadenlos. Gnadenlos offen. Gnadenlos direkt. Großartig, weil man einen Immendorff sieht, der keine Berührungsangst hat. Großartig, weil er Würde zeigt. Mut. Größe. Stärke. Unabhängigkeit. Energie, die übermenschlich scheint. Graef zeichnet mit der Kamera jene Momente nach, die zeigen, wie der Radius von Immendorffs Alltagsleben im Atelier kleiner wird, weil die Krankheit ihn immer unbeweglicher macht. Ihr gelingt das Psychogramm eines großen Künstlers. Manchmal sagen Bilder mehr als Worte
Was fühlt ein Künstler, wenn gerade seine Hände versagen, sein Arbeitsinstrument? Schlapp hängen diese zwei Hände nun am dünnen, schlaffen Körper herunter. Wenn er rauchen will, lässt er sich eine Zigarette zwischen die braunen Finger klemmen und schleudert den willenlosen rechten Arm ungelenk mit letzter Kraft an den Mund, so als würde er einen Sack mühsam über die Schulter hieven, und dann saugt er an der zitternden Tabakstange.
Später wollen seine Beine nicht mehr. Endstation Rollstuhl. „Warum sollte ich aufgeben?“, sagt Immendorff in die Stille. Dieser eine Satz sagt alles. Die Kunst schützt und hält ihn. Auch wenn die Themen inzwischen Todesmotive zeigen und er längst nicht mehr malen kann. Assistenten fertigen Collagen nach seinen Vorgaben. Tragen riesige Bildertableaux hin und her.
Die Lunge. Langsam lässt Immendorff die Lunge in Stich. Jeder Atemzug braucht Disziplin. Das Formulieren fällt schwer. Er empfängt Kanzler Schröder. Er kämpft. Alle ahnen, dass es Immendorffs letzter Einsatz ist. Graefs Kamera fährt an Immendorffs Gesicht, er sagt nichts. Manchmal sagen Bilder mehr als Worte.
zurück zur Auswahl