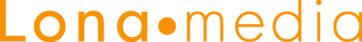Immendorff. Letztes Kapitel
22.05.2008
Berliner Zeitung
zurück zur Auswahl
Ein Jahr nach dem Tod des "Café Deutschland"-Malers kommt Nicola Graefs Film ins Kino Ingeborg Ruthe
Ein paarmal ist von Unsterblichkeit die Rede in diesem berührenden, auch befremdenden Film, in dem der Hauptdarsteller selbst das kritische, ruppige Element ist, nicht etwa das Filmkonzept. Aber derjenige, der sterben wird, sagt das große Wort nie. Das nehmen andere in den Mund, Wegbegleiter, Kollegen. Und stumm reden auch die Bilder, im Atelier, in Ausstellungen, die der 1945 geborene Maler noch vor seinem Tod am 28. Mai 2007 mit letzter Souveränität ausstattet. "Gibt es keinen Zoff, mache ich mir welchen. Gibt es keine Revolution, mache ich eine. Ist Deutschland bequem, mache ich es unbequem." Mit Jörg Immendorffs anmaßender Lebensmaxime beginnt der Film von Nicola Graef. Der Maler und Beuys-Schüler selbst zog das auch durch bis zuletzt: ungeduldig, meist mürrisch und unverblümt im Urteil. Aber immer so, dass jene, die das ertragen müssen, daraus etwas lernen. Sogar noch der schroff abgewiesene junge Bewerber an der Düsseldorfer Kunstakademie, der seine Blätter gleich wieder einpacken muss.
"Ich. Immendorff" begleitet in unaufgeregten Sequenzen, ohne krasse Schnitte und mit sehr genauen Detailaufnahmen die letzten beiden Lebensjahre des unheilbar an ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) leidenden Künstlers, der einer der wichtigsten im Deutschland der Nachkriegszeit gewesen ist. Regisseurin Nicola Graef spart das Skandalkapitel, die Drogen und die Nuttenaffären in Immendorffs Malerfürstenleben aus. Sie beleuchtet in unverhohlener Bewunderung - aber sehr aufschlussreich - die Persönlichkeit des empfindlichen Egomanen, der es vom Protestkünstler zum Hofmaler von Kanzler Schröders Gnaden brachte.
Entstanden ist ein eher undramatischer Epilog über das Drama Kunst, Krankheit, Hinfälligkeit und das unwiderruflich Kommende - den Tod. Und über den radikalen Trotz des Sterbenden.
Denn Immendorff, gelähmt im Rollstuhl, mit letzter Kraft, aber süchtig rauchend, mühsam mit Strohhalm trinkend, lebt in diesem intimen Film, in dem immer wieder die Mutter, die abgelegte und die neue Ehefrau zu Wort kommen, mit ganzer letzter Kraft. Erzählt wird, im Wechsel mit Rückblenden in die Kindheit und die wilde Düsseldorfer Studentenzeit, das letzte Kapitel dieses in Deutschland schmerzlich fehlenden, rabiat kritischen Chronisten der Gegenwart. Immendorff ist in jeder Filmphase ein Held, als den ihn auch seine Freunde und Wegbegleiter sehen: der kindliche Jonathan Meese, Markus Lüpertz, seine Galeristen, Museumsdirektoren und Kollegen. Nicht zuletzt sein Charité-Arzt Thomas Meyer. Immendorff ist der bis zum Äußersten beherrschte, den Ìberblick behaltende Meister. Der unabhängige Geist, der sagt, was er denkt und der zuletzt von einem Stab Assistenten - seinen Ersatz-Armen, -Händen, -Fingern - tun lässt, was er sagt. Mit den Augen, mit der Stimme dirigiert er hartnäckig die Helfer. Die Kamera ist mal auf sein Gesicht, mal auf das des jeweiligen jungen Mitarbeiters gerichtet. Der muss das übelgelaunte Insistieren des kaum einmal lobenden Perfektionisten ertragen. Dann, im Gespräch allein, erklärt einer der Assistenten stoisch und voller Respekt für seinen gepeinigten "Peiniger", es gehe ums Ergebnis. Nur darum. Und Immendorff spricht von der "Disziplin der Einweisung und Anleitung", mit der seine Kunst entstehen kann, derweil, wie er lakonisch konstatiert, der hinfällige Körper immer bewegungsloser werde. Einmal, es ist mitten im riesigen, turbulenten Düsseldorfer Atelier, sagt er lapidar, Ordnung im Chaos sei seine größte Sehnsucht. Und an anderer Stelle - im Atelier wird gerade die Vollendung des Porträts von Ex-Bundeskanzler und Immendorff-Intimus Gerhard Schröder gefeiert - sitzt der Maler abseits im Rollstuhl, die Hände schon voller Wasser, den Luftröhrenschnitt verbirgt er mühsam hinter einem Seidenhalstuch. Ohne Bitterkeit meint er, am Ende sei jeder allein.
Seine Einsamkeit - obwohl er doch allenthalben im Mittelpunkt steht und seine anmutige junge Frau, die aus Bulgarien stammende Malerin Oda Jaune, ihre innige Liebe und Treue zu ihm allüberall demonstriert - wird fast körperlich spürbar in den Filmsequenzen, in denen Immendorff 2005 seine quasi "Vermächtnisausstellung", in der Neuen Nationalgalerie Berlin aufbaut. Die Vernissage von "Male Lago", in denen seine bronzenen Alter-Ego-Affen, seine Café-Deutschland-Bilder, die Propaganda-Werke aus der maoistischen Phase und die späten, Dürers Apokalypse wahlverwandten Tafeln zum Thema Tod vor blutroten Wänden auftreten, sind ein riesiges Brimborium. Mit Promis ohne Ende, die sich, Bussi links, Bussi rechts, über den Maler im Rollstuhl hinweg begrüßen.
Im Filmabschnitt danach sitzt Immendorff wieder im Atelier und spricht voller Verachtung über "Angsthasen" in der Kunst, die es sich bloß mit keinem verderben wollen. Er sagt, Kunst sei, was über das Banale hinauszuzuwachsen suche. Und seine junge Frau gesteht, sie wisse nun, wie wertvoll Zeit sei.
Ich. Immendorff Deutschland 2007. Regie: Nicola Graef, Dokumentarfilm; 98 Minuten, Farbe.
zurück zur Auswahl