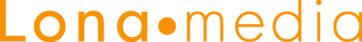„Ich. Immendorff“ besteht in der Kombination von Privatmensch Immendorff und dem Einblick in den künstlerischen Schaffensprozess.
13.05.2008
Filmstarts.de
zurück zur Auswahl
ALS [1] ist eine sehr seltene Krankheit. Umso medienwirksamer werden prominente Fälle aufbereitet. Der wohl berühmteste ALS-Erkrankte ist der Astrophysiker Stephen Hawking, bei dem die Krankheit ungewöhnlich langsam fortschreitet. Normalerweise tritt der Tod innerhalb von fünf bis sieben Jahren nach der Diagnose ein, während Hawking nun schon seit mehr als 40 Jahren mit der Krankheit lebt. Ebenso gilt Dieter Dengler, der die Hauptfigur in Werner Herzogs Kriegsdrama Rescue Dawn ist, als Opfer der Krankheit. Einer der wichtigsten deutschen Künstler der Gegenwart, Jörg Immendorff, erlag am 28. Mai 2007 der ALS. Als Immendorff die Diagnose gestellt wurde, war eine der Konsequenzen, dass er einem Filmteam gestattete, ihn im Alltag zu begleiten, wichtige Stationen in seinem Leben zu dokumentieren und Interviews mit ihm zu führen. Bereits 2007 war eine Kurzfassung von 45 Minuten dieses Zusammentreffens im deutschen Fernsehen zu sehen. Nun kommt eine mehr als doppelt so lange Fassung von „Ich. Immendorff“ in die Kinos. Das Porträt Immendorffs, das Nicola Graef damit vorlegt, schwankt zwischen dokumentarischer Hommage an den Künstler und kühler, distanzierter Beobachtung. Das Reizvolle an „Ich. Immendorff“ besteht in der Kombination von Privatmensch Immendorff und dem Einblick in den künstlerischen Schaffensprozess.
Zur Bildergalerie Der Auftakt: Das Bild eines leeren Künstlerateliers. Dieses ist der Hauptaufenthaltsort des deutschen Malers Jörg Immendorff. Die Atelierluft, so sagt er, brauche er so dringend zum Leben, wie die normale Luft zum Atmen. Hier schöpft er Kraft und Energie, um weiterzumachen. Weitermachen heißt ganz konkret, nach wie vor Kunst zu produzieren. Nachdem Immendorff jedoch die Diagnose ALS bekommen hat, die Krankheit sich bemerkbar machte, brauchte er eine neue Strategie, um künftig Bilder zu produzieren. Die Lösung lag darin, helfende Hände anzustellen, die die Arbeit nach seinem Wunsch ausführen. So sieht man ihn, in seinem Stuhl sitzend, wie er den Gehilfen Anweisungen gibt, wie seine Bilder auszuführen sind. Stetig erklärt der Künstler die Methode, seine Auffassung von Kunst und spricht offen über seine Situation. Damit ist der Berufsalltag von Immendorff jedoch bei weitem nicht erschöpft. Die Lehrtätigkeit als Professor an der Düsseldorfer Kunstakademie bildet eine weitere Konstante. Auch hier zeigt sich Immendorff als klarer Geist mit scharfem Urteilsvermögen. Ein Highlight ist die Organisation der Ausstellung „Male Lago – unsichtbarer Beitrag“, die in der Neuen Nationalgalerie in Berlin im Herbst 2005 eingerichtet wird. Man sieht, wie unter der Regie von Immendorff eine Ausstellung entsteht, was hinter dem Konzept steckt und lernt so wichtige Stationen im künstlerischen Schaffen kennen.
Zur Bildergalerie Diese Aktivitäten aus dem gegenwärtigen Berufsalltag des Künstlers werden immer wieder durch Interviews unterbrochen oder mit Privatem kontrastiert. Immendorffs Ehefrau Oda Jaune, ebenfalls Künstlerin und seine ehemalige Schülerin, berichtet vom Ehemann, Vater, Künstler und Patienten. Zum ersten Mal vor der Kamera äußert sich auch Mutter Irene Immendorff zum Leben ihres Sohnes. Oft unter Tränen erinnert sie sowohl an wichtige private Lebensstationen ihres Sohnes als auch an die frühen Gehversuche als Künstler. Komplettiert wird dieser Blick auf den Menschen Immendorff von langjährigen Weggefährten wie dem Freund und Malerkollegen Markus Lüpertz, der Immendorff ebenfalls seit frühen Lehrjahren kennt. Höhepunkte der besonderen Art markieren die Besuche von Freunden im Atelier, die Abwechslung ins Tagesgeschäft Immendorffs bringen. Schriftsteller Tilmann Spengler und Enfant terrible der aktuellen deutschen Kunstszene, Jonathan Meese, sind regelmäßig zu Gast. Dabei werden alte Geschichten ausgetauscht, über Kunst geplaudert, oder man porträtiert sich gegenseitig. Trotz dem allgegenwärtigen Bewusstsein über die schwere Krankheit entsteht so etwas wie Normalität und Gelöstheit. Nach und nach verschlimmert sich jedoch der gesundheitliche Zustand Jörg Immendorffs und die Kamera zieht sich langsam aber stetig zurück...
Zur Bildergalerie Gleichgültig welcher Gattung ein Film angehört – Literaturverfilmung, Dokumentation, Fernsehfilm, etc. – entscheidend ist die Auswahl der Szenen, Themen, usw., die ihren Weg in den Film finden. Bei „Ich. Immendorff“ wurde nun die Entscheidung getroffen, dass sowohl Künstler als auch Privatmann Immendorff repräsentiert werden soll. Doch was gehört zum privaten oder beruflichen Menschsein, zum Mensch Immendorff, dazu und was nicht? Christoph Schlingensief würde auf ersteres bestimmt antworten, dass zum Menschen vor allem auch seine Fehler gehören, und dass das auch gut so ist. In „Ich. Immendorff“ ist jedoch kaum Platz für menschliche Makel, seien sie auch noch so nachvollziehbar. Am Image des großen, unnahbaren Ausnahmekünstlers soll nicht zu stark gekratzt werden. Insofern ist es doch sehr auffällig, dass zum Beispiel die Aufsehen erregende Affäre aus dem Jahr 2003 von niemandem auch nur mit einer Silbe erwähnt wird. Und das obwohl sie in den Zeitraum fällt, da die Dreharbeiten schon begonnen hatten. Damals wurde Immendorff von der Polizei überrascht, als er sich mit immerhin neun Prostituierten und einer erheblichen Menge Kokain in einer Luxus-Suite in Düsseldorf vergnügte. Sicherlich kann es hier nicht darum gehen, auf einmal Toten Schlechtes nachzusagen. Dennoch ist die Dokumentation ansonsten immer stark darum bemüht, einen neutralen, ehrlichen Beobachterstandpunkt einzunehmen. Konsequenterweise bekommt die dokumentierende Seite, also die Filmemacher, kein Gesicht im Film, keine Stimme, die Fragen stellt. Aufgezeichnet werden nur die Antworten oder unkommentiertes Geschehen.
Zur Bildergalerie Mit zu dem Eindrücklichsten, was „Ich. Immendorff“ zu bieten hat, gehört wohl der Einblick in die Arbeitsweise des erkrankten Künstlers. Ohne die Abläufe im Atelier gesehen zu haben, ist es nur sehr schwer vorstellbar, wie es einem Künstler mit gelähmten Armen und Beinen möglich ist, Bilder zu malen. An dieses Thema knüpfen sich spannende Fragen nach der Autorenschaft von Kunstwerken an. Sind die Bilder, die von den Helfern gemalt werden, noch echte Immendorffs? Dieser gibt zwar Anweisungen und führt seine Ideen aber nicht mehr selbst auf der Leinwand aus. Gelangt etwas von der Kunstvorstellung der Helfer mit aufs Bild? Was macht eigentlich einen Künstler zum Künstler? Immendorff spricht in Gesprächen auch solche sensiblen Themen immer wieder an und hält überraschende Antworten bereit. Betrachtet man lediglich den Ablauf der Bildproduktion als solchen wirkt der Umgangston in der Kunstwerkstatt sehr schroff. Die Gehilfen schwirren geisterhaft durch die Räume und sprechen nur sehr zaghaft und zurückhaltend, fast eingeschüchtert. Das Künstler-Ego Immendorffs dominiert die Szenen.
Dieser Eindruck deckt sich mit dem Filmtitel, der offen legt, dass mit Immendorff ein stark ausgeprägtes „Ich“ im Mittelpunkt steht. Nicht nur, dass die Personen im direkten Umkreis des Künstlers wie Geister wirken, manchmal stellt sich auch das Gefühl ein, die Crew um Nicola Graef sei ebenfalls in diesen Bannkreis geraten. Die Regie im Film macht sich nur spärlich bemerkbar. Formal Außergewöhnliches fehlt ebenso wie wirklich Störendes. Die Sache läuft manchmal etwas zu glatt und sauber ab, fast so, als würde eine zu aufwändige Gestaltung des Films dem Künstler, der porträtiert werden soll, die Show stehlen. Für eine Dokumentation, die in der Neuauflage für die Kinoleinwand konzipiert wurde, bietet „Ich. Immendorff“ in dieser Hinsicht zu wenig. Um sich dem Leben und Schaffen von Immendorff anzunähern, loht sich der Besuch im Kino jedoch allemal. Der Werdegang des Künstlers wird, soweit er nicht in die Zeit der Produktion fällt, mit viel Bildmaterial illustriert. Ebenso ermöglichen die vielen Interviewpartner, die teils zum ersten Mal gewonnen werden konnten, eine ungewöhnliche Perspektive auf den Menschen hinter den Bildern.
[1] Amyotrophe Lateralsklerose – kurz: ALS – ist eine Erkrankung des Zentralnervensystems, die bisher als unheilbar gilt. Vom Rückenmark ausgehend kommt es im Verlauf der Krankheit zu Lähmungen der Muskulatur des Bewegungsapparates, da die Nervenbahnen unterbrochen werden. Zunächst ist vor allem die Peripherie des Körpers betroffen, also Arme und Beine, deren willentliche Steuerung zunehmend schwer wird. Die häufigste Todesursache ist der Erstickungstod oder Herzversagen, wenn sich die Lähmung auf die Lunge oder das Herz ausbreitet.
Christian Schön
zurück zur Auswahl